Magdalena Möbius über Frauen in der Kirche
Auch 500 Jahre nach der Reformation ist Geschlechtergerechtigkeit in den Kirchen immer noch nicht erreicht. Es ist nach wie vor viel zu tun, erklärt Pfarrerin Magdalena Möbius.
den Kulturingenieuren
Die Kulturingenieure verarbeiten komplexe Sachverhalte, Prozesse oder Zeitläufte zu bekömmlicher Kost. Den technischen Vorgang nennen sie Komplexitätsreduktion. Wir haben sie gefragt, wie sie bei Luther herangegangen sind.
einer Wahlhelferin
Rund 28.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger sind zur Bundestagswahl als Wahlhelfer im Einsatz. Ute Hinze ist eine von ihnen. Seit über 20 Jahren ist sie schon dabei. Uns hat sie erzählt, was sie als Wahlhelferin macht und wie ein Wahltag abläuft.
Thorsten Faas über Wahlumfragen
Die Bundestagswahlen stehen kurz bevor und manch einer wüsste jetzt schon gern, wie sie ausgeht. Das Interesse an Wahlumfragen ist groß. Aber Vorsicht: Diese zeigen uns Stimmungsbilder, sind aber keine Voraussage des Wahlergebnisses, erklärt Politikwissenschaftler Thorsten Faas.
Thomas Heinrichs über Humanismus als Integrationsfaktor
Die Debatte um Integration hat sich in den letzten 25 Jahren von den Ethnien auf Religionen verschoben. Das ist nicht unproblematisch, da dadurch zum Teil Muslime erst geschaffen werden, meint Rechtsexperte Thomas Heinrichs. Der Humanismus könnte eine Alternative bieten.
Roman, Jörg, Janine, Nadine und Kathrin über die Bundestagswahl
Warum Menschen mit geistiger Behinderung wählen wollen und was sie dafür tun.
Daniel Hegedüs über Demokratie in Ungarn
der Brandenburger Verfassung
Am 14. Juni 1992 gaben sich die Brandenburger per Volksentscheid ihre eigene Verfassung. 25 Jahre Brandenburger Verfassung - da stellt sich zunächst die Frage: Was ist eine Verfassung und wozu ist sie nütze? Darauf antwortet die Verfassung gern selbst.
Doris Lemmermeier über islamisches Leben in Brandenburg
Brandenburg hat seit 2015 25.000 geflüchtete Menschen aufgenommen. Ein großer Teil von ihnen kommt aus islamisch geprägten Ländern. Was wissen wir über unsere neuen Mitbürger?
Rolf Schieder über staatliche Steuergelder für das Reformationsjahr
Rolf Schieder kritisiert die Selbstverständlichkeit, mit der staatliche Steuermittel für das Reformationsjahr ausgegeben werden. Der Berliner Religionsprofessor findet, alle Steuerzahler, auch die Nicht-Gläubigen, haben das Recht auf eine Erklärung.
Heidrun Kämper über sprachliche Umbrüche
Hat da etwa jemand »Asylant« gesagt? Und nun? Die Germanistin Heidrun Kämper beobachtet am Institut für Deutsche Sprache den Diskurs über Geflüchtete. Ein Gespräch darüber, wann und wie wir reagieren sollten.
Philip Kovce und Daniel Häni über ein bedingungsloses Grundeinkommen
Was macht ein bedingungsloses Grundeinkommen mit uns, was macht es mit der Gesellschaft? Philip Kovce und Daniel Häni haben ein Buch darüber geschrieben und in der Landeszentale vorgestellt. Wir haben nachgehakt…
Andrzej Ancygier über Umwelt- und Energiepolitik in Polen
Viele Deutsche wissen wenig über die Umwelt- und Energiepolitik in Polen und haben daher ein sehr starres Bild. Aber stimmen diese Vorstellungen noch? Der polnische Energie- und Umweltexperte Andrzej Ancygier spricht über neue Entwicklungen in diesem grenzüberschreitenden Thema.
Ralph Hertwig über den Sinn und Unsinn von Nudging
Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, kritisiert den Versuch, Bürger mit psychologischen Tricks zu gewünschtem Verhalten zu bewegen.
Sabine Tischendorf und Geraldine Mua Ikia über die Rechte von Frauen
Die Landeszentrale hat nach der Veranstaltung "Frauenrechte sind Menschenrechte" mit Sabine Tischendorf und Geraldine Mua Ikia gesprochen. Beide machen sich für die Rechte von Frauen stark.
Monika von der Lippe über die Debatte um Gleichstellung
Anlässlich der Ausstellungseröffnung "Frauen hört die Signale!" in der Landeszentrale sprachen wir mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landes Brandenburg über die Debatte um Gleichstellung und was eine Gleichstellungsbeauftragte eigentlich macht.
Christoph Bruckhoff über die Rolle der katholischen Kirche in Polen
In Polen spielt die katholische Kirche eine herausragende Rolle in der Gesellschaft. Man sollte das Land aber nicht auf die Kirche reduzieren. Für ihn sei Polen immer auch Europa, meint Christoph Bruckhoff, evangelischer Superintendent i.R. des Kirchenkreises Frankfurt (Oder).
Till Stromeyer über Diskussionen mit Rechtspopulisten
Mit Neonazis und Rechtspopulisten diskutieren - geht das und wenn ja, wie? Argumentationstrainer Till Stromeyer gibt Tipps und zeigt, wo Dialogbereitschaft Grenzen hat.
Piotr Buras über Polen in Europa
Polen ist in den letzten Jahren als europäisches Erfolgsmodell gefeiert worden. Nach den letzten Wahlen fragen sich nun Viele: Wo liegt Polen in Europa?
Basil Kerski über Polens Rolle auf dem Weg zur Deutschen Einheit
Der Anteil der Polen an der deutschen Einheit wird in der deutschen Öffentlichkeit kaum beachtet. Zu Unrecht, meint Basil Kerski, Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig.
Henrike von Platen über Quotenfrauen
In Brandenburg bewegt sich etwas in Sachen Gleichstellung von Frauen und Männern. Ein neues Rahmenprogramm und ein gemeinsames Leitbild für die Landesverwaltung sollen in den nächsten Jahren gleiche Chancen für Frauen und Männer sichern. Über politische Vorgaben und warum Quotenfrauen mutig sind, spricht Henrike von Platen, Präsidentin des Frauennetzwerks Business and Professional Women (BPW) Germany.
Anja Besand über Politische Bildung an beruflichen Schulen
Lernende an Berufsschulen haben großes Interesse an Politik. Sie sind aber auch offen für rechtsextreme oder weit rechts angesiedelte Einstellungen. Für die politische Bildung ergibt sich daraus ein anspruchsvolles Handlungsfeld, meint Anja Besand von der TU Dresden.
Peter Knösel über Asylrecht in Deutschland
Über das deutsche Asylrecht und die Handlungsspielräume, die es bietet, spricht Peter Knösel, Professor für Rechtswissenschaften an der Fachhochschule Potsdam.
Alexander Häusler über das Schreckgespenst Islamisierung
Das Thema Zuwanderung ist mit viel Zustimmung, aber auch Ängsten verbunden, die vor allem muslimische Zuwanderer betrifft. Die rechte Szene versucht, über die Furcht vor dem Islam an Einfluss zu gewinnen. Welche Rolle die AfD dabei spielt, erklärt Alexander Häusler.
Matthias Jobelius über die "Mär vom Sozialtourismus"
Zuwanderung gehört zu den am meisten diskutierten Themen in Deutschland. Die Rede vom „Sozialtourismus“ ist dabei politikfähig geworden. Matthias Jobelius hat die Zuwanderung von Rumänen und Bulgaren nach Deutschland untersucht.
Monika Schwarz-Friesel über Sprache als eine Form der Gewalt
Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel untersucht den aggressiven und verhetzenden Sprachgebrauch gegenüber Juden im Internet. Im Interview mit ARD.de erklärt sie, warum Sprache eine Form der Gewalt sein kann und wieso davon im Netz besonders häufig Gebrauch gemacht wird.
Tobias Vogt über die demografischen Folgen von Mauerbau und Mauerfall
Wie sehr sich Ost und West nach dem Fall der Mauer angenähert haben, lässt sich auch von Sterblichkeits- und Geburtenraten ablesen. Tobias Vogt vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock spricht über ein "ergiebiges Thema".
Siegfried Schiele und Martina Weyrauch über politische Bildung heute
Braucht die politische Bildung nur längere Arme, um mehr Breitenwirkung zu erzielen oder geht es um neue Formen und Wege? Martina Weyrauch und Siegfried Schiele diskutieren über Herausforderungen für die politische Bildung im 21. Jahrhundert und die Rolle der Landeszentralen.
Monika Stefanek über deutsch-polnische Klischees in den Medien
Polen und Deutsche scheinen nur wenig übereinander zu wissen. Daher bleiben Klischees und Vorurteile so lebendig, meint die Journalistin Monika Stefanek. Sie kennt die Medienlandschaft beider Länder und sieht Versäumnisse in der Berichterstattung dies- und jenseits der Oder.
Sylvia-Yvonne Kaufmann über die europäische Idee
Europa - das ist vor allem eine Wertegemeinschaft, meint Sylvia-Yvonne Kaufmann. Die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments setzt gegen die Euro-Krise auf Bürgerbeteiligung. Für ihr Engagement erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Rudolf J. Schlaffer zur Bundeswehr in der wehrhaften Demokratie
Das Ende der Weimarer Republik war eindrücklich, die Demontage der Demokratie umfassend. Das Grundgesetz erlaubt es daher der Demokratie, sich gegen Feinde zu verteidigen. Oberstleutnant Dr. Rudolf Josef Schlaffer spricht über „wehrhafte Demokratie“, „Innere Führung“ und die Rolle der Bundeswehr.
Juliane Wetzel über Antisemitismus
In Deutschland ist Antisemitismus ein Tabu-Thema in der Politik. Fast jeder fünfte Deutsche denkt dennoch antisemitisch. Mit der Landeszentrale spricht Dr. Juliane Wetzel über Antisemitismus in der Gesellschaft, Kritik an Israel und warum politische Bildung nicht das Allheilmittel sein kann.
Martina Weyrauch über politische Bildung
Was kann und soll politische Bildung leisten? Auf jeden Fall darf niemand dazu gezwungen werden, meint Dr. Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale im Gespräch mit Karen Bähr.
Klaus Hanfland über Spielräume in der Finanzierung extremistischer Parteien
Als Regierungsdirektor im Deutschen Bundestag ist er unter anderem zuständig für die Bewilligung von Ansprüchen auf Parteienfinanzierung.
Volker Epping über die staatliche Finanzierung der NPD
Prof. Volker Epping schrieb 2008 für die niedersächsische Regierung ein Gutachten, wie die staatliche Finanzierung der NPD verhindert werden könnte - auch wenn die Partei nicht verboten wird. Mit der Landeszentrale spricht er über rechtliche Wege und warum die Politik zögert.
Simon Franzmann über die Wahlrechtsreform 2012
Dr. Simon Franzmann, Politikwissenschaftler der Universität Potsdam, ist Experte für Wahlrechtsfragen. Im Interview mit der Landeszentrale spricht er über Probleme des bisherigen Wahlrechts, Vorschläge aus der Wissenschaft und das Brandenburger Wahlrecht.
Fabian Virchow und Christoph Kopke über Parteienverbote
Die Ermittlungen um die rechtsextreme, terroristische Vereinigung NSU haben die Debatte um ein NPD-Verbot neu belebt. Ein aktuelles Forschungsprojekt könnte nun Argumente für Befürworter und Gegner eines Verbots aus einer anderen Perspektive liefern. Im Fokus: die staatliche Verbotspolitik der Bundesrepublik der letzten 60 Jahre.
Teilen auf













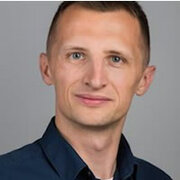























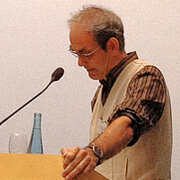
Neuen Kommentar hinzufügen